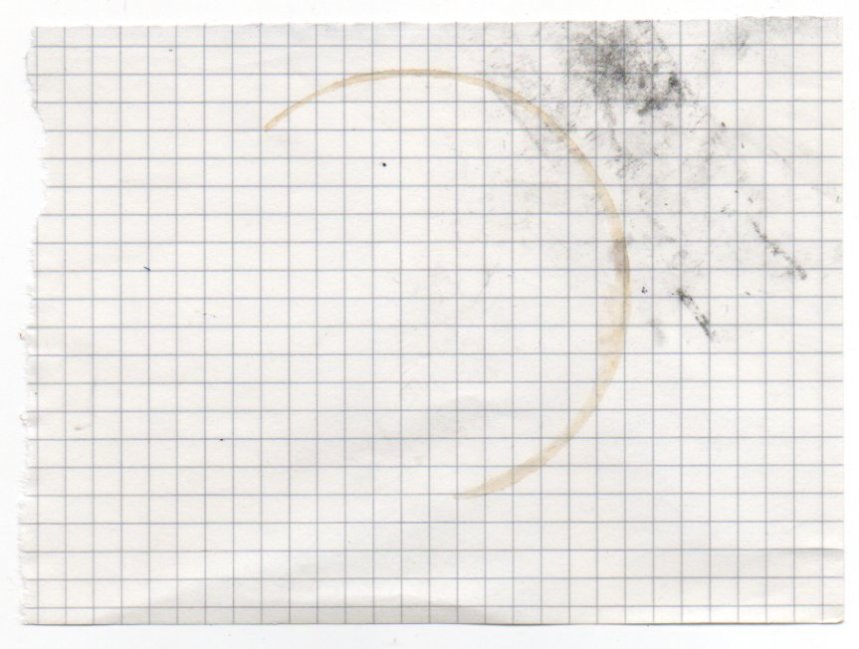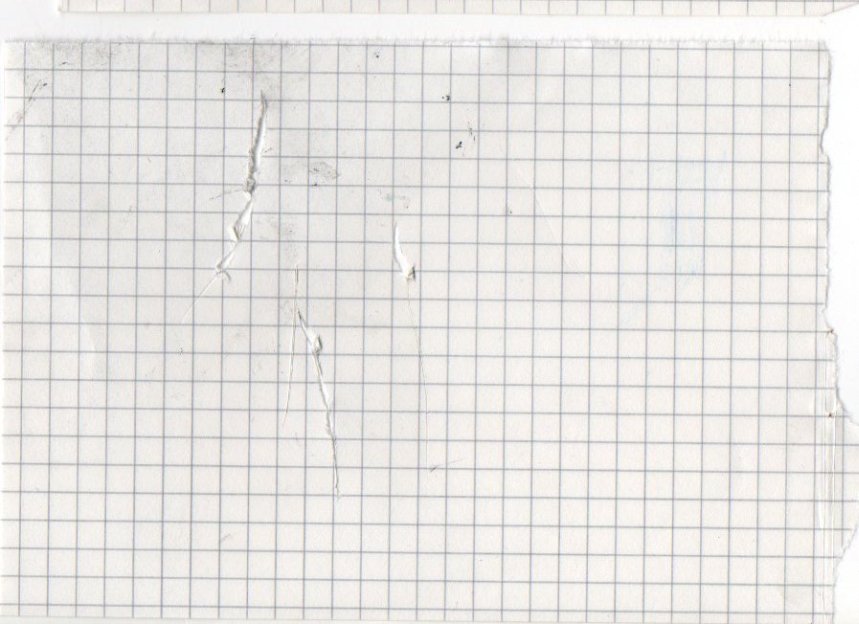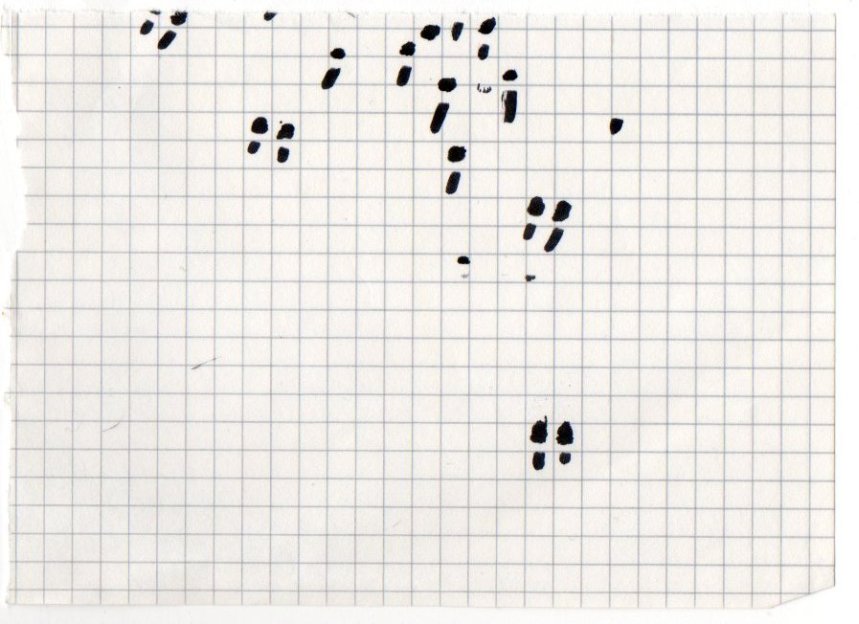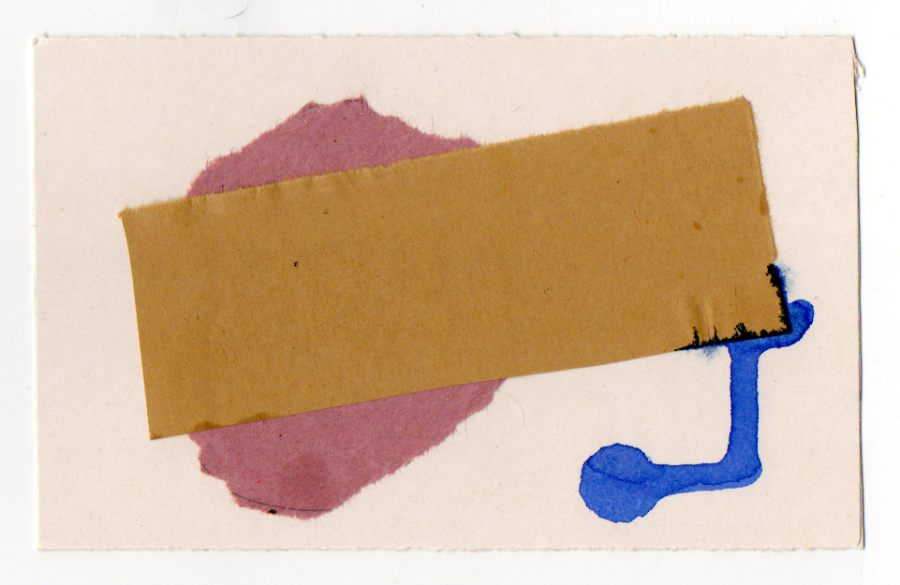„Ich habe einen riesen Berg Wasser gekocht“ wäre so ein Satz, den die Mutter benutzt hätte, wenn sie aus der Küche heraus uns etwa mitteilen wollte, es gäbe demnächst dann Nudeln oder Tee. Daran musste ich denken, als ich zusätzlich zu Herd und Waschmaschine auch noch den Wasserkocher in Betrieb setzte. Der Herd ist zwar Gold wert, inzwischen, täglich unterschiedlich viel, jedoch nicht gerade leise, wenn er sich selbst mit Umluft auf 275° C hochschaukelt. Er erinnert mich regelmäßig an das Geräusch, welches etwa auf einer der Nordseefähren, oder einer x-beliebigen anderen Fähre irgendwo auf einem der sieben Weltmeere, bspw. im Passagierraum oder dort, wo die Koffer der Touristen in den großen Regalen liegen, zu hören ist. Ich dachte an diesen oft gesagten, merkwürdigen Satz der Mutter und daran, wie der in ihm enthaltene Widerspruch zugleich faszinierte und verstörte. Die Waschmaschine stampfte und kam langsam in Fahrt, wie auch das Jahr langsam Fahrt aufgenommen hatte, jetzt im Februar, mitsamt der nassen Fracht. Dazu noch der Geschirrspüler und wie gesagt, der Wasserkocher. Mir war, als schwankte der Boden tatsächlich ein wenig und ich, inmitten meiner Küche, befünde mich auf großer Fahrt. Im Küchenradio lief ein japanischer Sender, der alle fünf Minuten einen science-fiction-mäßigen Jingle abließ. Ich verstand kein einziges Wort. Das gefiel mir gut. So fuhren ich und der dampfende Wasserkocher hinaus auf die offene See, wo nur die Möwen um den Schornstein kreisen würden, im süßen Schiffsdiesel-Rauch, mit ihrem Gelächter und ihrem Hunger nach Fisch. Warum stehen an den Stränden keine Schilder, dass die Möwen nicht zu füttern seien? Weil es jeder höchstens einmal probiert. Den Backofen könnte ich auch mal wieder sauber machen mit dem Pommes-Fett. Ich holte schon die Kapern aus dem Kühlschrank und das Glas mit den Sardellen, nun wurde ich ganz und vollends zum Smutje auf Kapernfahrt und die Küche ist die Kombüse.
Der Regen steht diagonal zwischen Meer und Himmel und das Bullauge ist unter Wasser, der Tag ist stürmisch zwischen all den großen Wünschen, die in den Herzen herumgetragen werden. Mit Volldampf geht es Richtung Schalttag, um den Kurs um 0,2425 zu korrigieren, um die sich Papst Gregor XIII oder einer seiner Vasallen verrechnet hatte, Jahre bevor einem seiner Stellvertreter-Nachfolger Kurzwellensender zur Verkündung seiner sog. frohen Botschaft an die ganze Welt und das Universum zur Verfügung standen. Die Verkündung der einigermaßen korrekten Uhrzeit circa alle Stunde einmal ist von großer Bedeutung, ob im Radio oder per Glockenschlag vom Turme herab. Denn wer die endliche Zeit der Menschen kontrolliert, der kann auch das Wesen der Unendlichkeit deuten. Auch für die Schifffahrt, denn nach ihr berechnen wir unseren Standort und unsere Standpunkte, für alle die mit uns auf Kapernfahrt fahren. Einen Bart habe ich bereits und das Holzbein lasse ich mir auch noch wachsen, damit es Wurzeln schlägt wo keine Bäume stehen. Die Passagiere sind missmutige Engländer, die alle naselang it’s teatime rufen und mir ihre Tassen vor die Tülle halten, während ich meine Runde durch’s Kasino mache. Sie lesen in mitgebrachten, Jahre alten Illustrierten, in denen bereits jedes Kreuzworträtsel gelöst ist. Einige handeln noch von Lady Di oder einer gewissen Fergie, den Titelblättern nach. Nudeln mit Kapern-Sardellensauce muss man sich auch erstmal trauen, denen zu servieren. Sie arbeiten im Umspannwerk für den Offshore-Windpark, weit draußen vor den Inseln, der einem englischen Konzern gehört. Hier gibt es kein Internet und die sonstige Unterhaltungsmöglichkeit auf der vierstündigen Überfahrt besteht aus alten Bud Spencer Videotapes, die deutsche Synchronfassung. Die oft besser gelaunten Rückfahrts-Passagiere legen hier und da einen dieser Filme ein und machen sich dann ausführlich über die deutsche Sprache lustig. Glücklicherweise sind diese Meisterwerke der Filmkunst nicht sehr dialoglastig.
Vorgestern Nacht träumte ich, wir wären in Stockholm gewesen und hätten eine Fähre zum Flughafen nehmen sollen. Wir waren auf das falsche Schiff geraten, eine große Passagierfähre mit dem Ziel Kopenhagen, die in einem irrwitzigen Tempo ablegte und haarschaf um die Kaimauern bog, zur Hafenausfahrt hin und dann hinaus auf die See, der Scherengarten war der Einfachheit halber nicht vorhanden und wir alle sehr schnell in Kopenhagen, an der Landungsbrücke stand ein großes Tor, worauf ein Schild befestigt war, auf dem stand KØPENHAGEN geschrieben, genau wie es die Dänen schreiben. Ich wollte ein Foto machen und wir fanden es ganz wunderbar, durch den Zufall mit dem falschen Schiff hier gelandet zu sein. Zwei Wale schwammen im Hafenwasser, es waren nur ihre dunklen Rücken an der Oberfläche zu sehen. Am Morgen fiel mir dann dieser schöne Traum wieder ein, den Kafka in einem der Tagebücher aufgezeichnet hatte und dann später in seinem Roman „Amerika“ verwandte. Damit musste ich diesen Engländern wahrscheinlich nicht kommen.
Ich träume oft von Schiffen, Wasser und so.